


Gemeinde mit dem OT-Tschernitz
& OT-Wolfshain
Ortsname ist in alten Urkunden auch Zernischke,
Tschirnick oder Zernitz heißt geschrieben und stammt
sicherlich aus dem Wendischen Zernitz heißt das
Wendendorf.
Andere leiten es
ebenso wie
Zschorno von
Zarny ab =
schwarz, wegen
des dunklen
Ackerbodens.
Tschernitz
gehörte
ursprünglich
zu Schlesien,
unter das
Fürstentum
Sagan, im
Priebusschen; wie
Kromlau,
Jämlitz, Horlitza,
Lieskau und
Bloischdorf. Weil
Tschernitz von
Sagan in der
Luftlinie etwa
7 Meilen entfernt (
etwa 50 km westlich) wie auf einer Halbinsel in der
Niederlausitz liegt, wurde es 1817 in Bezug auf die
allgemeine Landes- und Polizeiverwaltung sowie auf
ständische Verhältnisse dem Särauer Landkreis zugeteilt.
Die Tschernitz nächstgelegene Stadt war Triebel, östlich
der Neiße. Seit 1360 führte die so genannte Salzstraße von
Sorau nach Spremberg über Triebel, Jerischke und
Dubraucke. Der letztgenannte Ort ist der benachbarte
nördlich von Tschernitz.
Erst viel später gehörte diese Gegend zum Landkreis
Gemeinde mit dem OT-Tschernitz
& OT-Wolfshain
Ortsname ist in alten Urkunden auch Zernischke,
Tschirnick oder Zernitz heißt geschrieben und stammt
sicherlich aus dem Wendischen Zernitz heißt das
Wendendorf.
Andere leiten es
ebenso wie
Zschorno von
Zarny ab =
schwarz, wegen
des dunklen
Ackerbodens.
Tschernitz
gehörte
ursprünglich
zu Schlesien,
unter das
Fürstentum
Sagan, im
Priebusschen; wie
Kromlau,
Jämlitz, Horlitza,
Lieskau und
Bloischdorf. Weil
Tschernitz von
Sagan in der
Luftlinie etwa
7 Meilen entfernt (
etwa 50 km westlich) wie auf einer Halbinsel in der
Niederlausitz liegt, wurde es 1817 in Bezug auf die
allgemeine Landes- und Polizeiverwaltung sowie auf
ständische Verhältnisse dem Särauer Landkreis zugeteilt.
Die Tschernitz nächstgelegene Stadt war Triebel, östlich
der Neiße. Seit 1360 führte die so genannte Salzstraße von
Sorau nach Spremberg über Triebel, Jerischke und
Dubraucke. Der letztgenannte Ort ist der benachbarte
nördlich von Tschernitz.
Erst viel später gehörte diese Gegend zum Landkreis
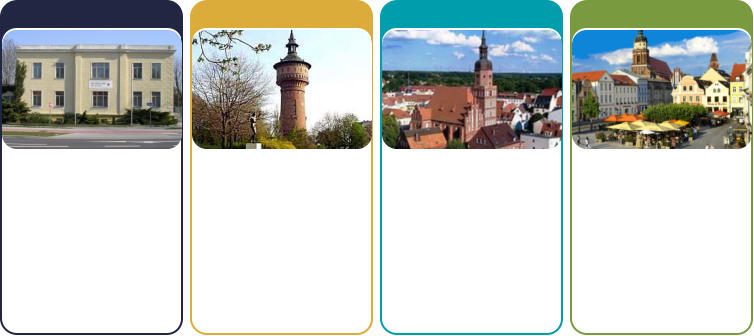
Döbern
Forst / Lausitz
Zu den größeren
Städten und
Gemeinden im
Umland von
Tschernitz gehören
Forst (Lausitz) 16 km
nördlich,
Spremberg
Cottbus
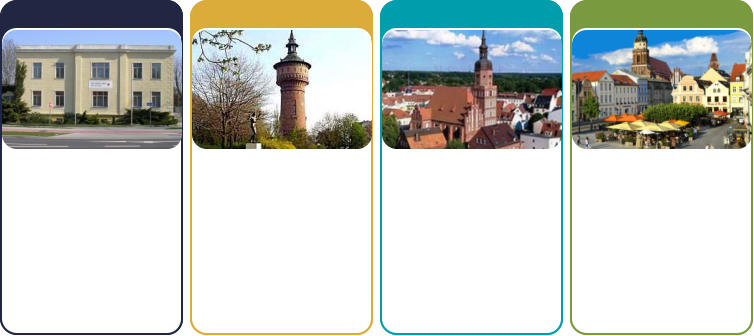
Döbern
Forst / Lausitz
Zu den größeren
Städten und
Gemeinden im
Umland von
Tschernitz gehören
Forst (Lausitz) 16 km
nördlich,
Spremberg
Cottbus
©Webgestalter & Studio VideoWeb Tschernitz










2024
Ticker
Nord-Stream: Selenski wollte Sprengung
NEW YORK Ein Bericht des «Wall Street Journal» verrät Details über die Operation, in der die Nord-
Stream-Pipeline gesprengt wurde.
«Ich lache immer, wenn ich in den Medien Spekulationen über eine riesige Operation lese, an
der Geheimdienste, U-Boote, Drohnen und Satelliten beteiligt sind», meinte ein ukrainischer
Offizier in Bezug auf die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September 2022. «Das Ganze
ist aus einer durchzechten Nacht und der eisernen Entschlossenheit einer Handvoll Menschen
entstanden, die den Mut hatten, ihr Leben für ihr Land zu riskieren.» Das «Wall Street
Journal» sprach mit dem Offizier, nachdem bekannt geworden war, dass ein Haftbefehl gegen
einen ukrainischen Staatsbürger wegen der Nord-Stream-Sabotage ausgestellt worden war.
Offenbar waren laut der Zeitung sechs Menschen an der Operation beteiligt. Ein
Offizier im aktiven Dienst, der im Krieg kämpfte, war ein erfahrener Skipper der
geleasten Jacht, und vier waren erfahrene Tiefseetaucher, wie aus deutschen Ermittlungen weiter hervorgeht. Zur
Besatzung gehörten auch Zivilisten, darunter eine Frau in den 30ern, die eine private Tauchausbildung absolviert hatte.
Sie wurde spezifisch wegen ihrer Fähigkeiten ausgewählt, aber auch, um die Tarnung der Besatzung als Freunde in den
Ferien plausibler zu machen, so eine mit der Planung vertraute Person.
Laut dem «Wall Street Journal» war auch Selenski involviert. Er soll den ursprünglichen Plan genehmigt haben.
Der US-amerikanische Geheimdienst warnte Selenski offenbar davor, die Operation durchzuführen. Doch der Generalstabschef
Waleri Saluschni führte den Befehl, die Aktion zu stoppen. Als der Anschlag bekannt wurde, stellte Selenski dem
Zeitungsbericht zufolge seinen Generalstabschef zur Rede. Saluschni erklärte, er habe keinen Kontakt mehr mit dem
Sabotageteam aufnehmen können, um die Mission nicht zu gefährden.
SIMON MISTElI







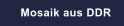




MAILAND Das italienische Modehaus Prada entwarf zusammen mit dem US-Raumfahrtunternehmen Axiom
Space den Weltraumanzug für die Mission Artemis 3, der gestern vorgestellt wurde. Der Anzug ist unisex, denn erstmals wird auch eine Frau auf den
Mond reisen. Die Schutzkleidung muss gegen Temperaturen von bis zu minus 203 Grad Celsius isolieren sowie vor Strahlung und Druck schützen. Zudem
muss sie ausreichend Sauerstoff für bis zuacht Stunden lange Mondspaziergänge liefern. BRe/DPA













